Auf dem Heimweg von einem netten sommerlichen Picknick auf einer viel zu trockenen Wiese, es ist schon dunkel. Der Weg zur nächsten S-Bahn-Station führt nur um ein paar Ecken in Mitte. Zu den Füßen eines nichtssagenden Graffiti-Kunstwerks an den zerbröckelnden Backsteinen des über hundertjährigen Bahngebäudes liegt Müll, zum Teil wenigstens in einem grauen Sack, unter Zweigabschnitten. Vorbei an den Touristen, über die Straße und hinein in die S-Bahn-Station. Ein Glück, bisher kein Zusammenstoß mit einem dieser bremsenlosen Fahrradfahrer, die an jeder Stelle in dieser Stadt plötzlich ohne irgendein vorheriges Anzeichen an einem vorbeirauschen. Selbst zu Hause auf dem Klo würde mich so einer nicht mehr wundern. Die Treppen hoch zum Bahnsteig: der käsig-fischige Geruch nach Pisse ist heute besonders dominant. Ich sehe mich um, sehe aber keinen – pardon – Penner, der nun eben ohne Dusche leben muss, in der Nähe, es muss wohl wirklich nur an den gelblich-angetrockneten Pfützen in den Ecken liegen. Zehn Minuten Wartezeit, naja, dann flaniert man halt ein bisschen den Bahnsteig auf und ab. Irgendwie sind es arme Seelen, die jetzt um diese Uhrzeit hier warten, mit ihren blauen Haaren oder löchrigen Hosen, manche mit müden Augen im Handylicht, manche mit schmutzigen Füßen. Während ich überlege, ob ich mich, da ebenso wartend, zu diesen armen Seelen dazurechnen sollte, gerät der Pissegestank langsam in den Hintergrund von Cannabisgeruch. In der S-Bahn schwäbische Abiturienten, man macht noch Party an der Warschauer Straße. Bleibt doch bitte einfach in eurer schwäbischen Kleinstadt und fresst Spätzle, ein gut gemeinter Ratschlag!
Umstieg am Ostkreuz, diesem Nachwende-Technik-Palias, das so gar nicht in das leicht verlotterte, aber natürlich bunte Partygänger- und Hausbesetzer-Viertel hier passt. Wie das feingliedrige Räderwerk einer Schweizer Uhr in der Cordsofaritze in einer Hippie-WG, zwischen Tabakkrümeln. Um einen halb-komatösen Raver mit weißen Plastik-Kopfhörern, absurd, da der Herr an die fünfzig ist, stehen ein paar Frühzwanziger, also Hipster. Soll man was machen, soll man nichts machen? Im Halb-Delirium ist der Kerl ja noch irgendwie ansprechbar, einen Arzt will er, ok, aber das will er vermutlich wöchentlich, wenn er so in seiner nassen Hose daliegt. Vielleicht auch ein Simulant, der nur schmarotzerisch in der Klinik zu einer warmen Dusche kommen möchte. Naja, man muss mal in die S-Bahn. Naja, man ruft mal kurz ’n Krankenwagen. Irgendjemand bleibt doch da, trotz allem. Zehn Ecstasy hat er drin, oder zwanzig, ok, ein bisschen weniger wäre wohl besser gewesen, aber kann ja jedem mal passieren, kennt man ja. „Was hat er,“, fragt einer der Sanitäter, „zu viel Drogen? Das hat hier jeder Dritte.“ Weitermachen können sie gleich bei den englischen Schülern, die ihr schlecht gekautes Falafel auf den Bahnsteig würgen. Oder, Moment mal, das sieht mehr nach Fleisch aus, es war wohl eher Döner. Nun gut, alle sind vorerst mit ihrem wohlverdienten Mindestmaß an Humanität versorgt, weiter also mit der nächsten S-Bahn.
Nach ein paar Stationen dann in den Nachtbus, nachdem man noch am Ende des Bahnsteigs sich einen Wild- oder sagen wir Mauerpinkler zum Vorbild genommen hat. Was soll man machen, man ist schon eine Stunde unterwegs und selbst wenn es Toiletten an dieser Station gäbe, wäre das die hygienischere Variante. Das vorausschauende Fahren des Nachtbusfahrers ist auf einen Prognosezeitraum von einer Sekunde beschränkt, vielleicht hat er eine Kurzgedächtnisstörung. An seinem Stehplatz also immer hin- und her-, vor- und zurückgeworfen, trainiert man jetzt wenigstens sowohl die Armmuskulatur als auch den Gleichgewichtssinn. Studien belegen ja, dass sich Großstädter im Alltag mehr bewegen, ob das da eingerechnet wurde? Ich versuche die begehrlichen Blicke der Tunte am Sitzplatz hinter mir zu ignorieren und versuche mich auf das schnelle, aber lustlose Tippen der Finger einer Teenagerin zu konzentrieren, mit ihren weiß lackierten Plastiknägeln. Aussteigen.
Im Schwindel der plötzlichen Bremsung versuche ich zu erkennen, ob die schmutzigen Gehwege und die beschmierten Häusern diejenigen sind, an die zu kommen ich beabsichtigt hatte. Im Vorbeigehen beobachte ich, wie drei Polen in fleckigen, grauen Jogginghosen einem an der Haltestelle wartenden Fahrgast das Päckchen Zigaretten aus der Hand klauen. Nur eine zu schnorren war dann doch ein bisschen mickrig, so reicht es doch etwas länger. Tja, auf sein Recht pochen und eine halbe Stunde auf den nächsten Bus warten oder zigarettenlos in diesen Bus steigen, die Qual der Wahl. Auf der anderen Seite haben sich zwei Halbstarke mit hochgekrempelten Jeans – macht man das hier noch oder womöglich schon wieder? – gegen das Warten auf den Anschlussbus entschieden und so gehen sie auf den letzten paar Metern bis nach Hause vor mir her. Ein Fuchs huscht über die Straße und die Straßenlöcher und, obwohl gerade erst richtig dunkel geworden, ist schon der allererste Anschein des Morgenanbruchs zu erahnen. Er spiegelt sich im Heckfenster des doch noch gekommenen, aber an der Haltestelle vorbeigefahrenen Anschlussbusses. In der Ferne der vertraute Ton einer beschleunigenden S-Bahn, etwas tiefer als das A einer Stimmgabel. Die Tür hinter mir fällt zu. Gute Nacht, Berlin.
Autor: h2ock
Gedanken zur Osterzeit
Immer wieder an Ostern dieses Kopfzerbrechen. Man befürwortet die Lehre Jesu, ihre Radikalität, versucht auch im Alltag einigermaßen als Christ zu leben und genießt so manchen Gottesdienst: aber was soll man von der Auferstehung halten? Wie kann man als Mensch des 21. Jahrhunderts, wie kann man als Naturwissenschaftler das denn bitte glauben, was da behauptet oder zumindest gelehrt wird – eine leibliche Auferstehung? Auf rein biologischer Ebene ist nach, sagen wir, einer Viertelstunde Gehirn ohne Sauerstoffversorgung definitiv Schluss, dann wird die Leiche nicht mehr lebendig, der Mensch ist tot. Würde es sich nicht gerade um Jesus handeln und hätte man nicht aufgrund seines Glaubens sich an diese Absurdität gewöhnt – kein Mensch käme heute auf die Idee, anzunehmen, eine Leiche, die tatsächlich und nachprüfbar tot war, käme irgendwie wieder zu einem Leben, wie sie es vorher besessen hat, und sei es auch eine einem noch so nahestehende und im Leben noch so gute Person gewesen. Man muss doch mal ehrlich sein: was in der Zeit der Antike für viele ein Wunder und somit ein Argument für die Übernahme Jesu Lehre oder eine Art Bestätigung derselben gewesen sein mag, ist doch heute ein ziemliches Hindernis, schlechterdings ein Stein des Anstoßes für den denkenden Menschen! Früher mag man geglaubt haben, weil Jesus leiblich auferstanden ist, heute muss man glauben, obwohl es diese Lehre der leiblichen Auferstehung gibt.
Es gibt gewisse Naturgesetze und ein Glauben an einen Gott, der durch unmögliche Wunder seine dann von ihm selbst festgelegten Naturgesetze sprengt, erscheint mir als Naturwissenschaftler lächerlich, dafür hänge ich zu sehr an der Natur, dafür stehe ich zu sehr auf dem Boden der Tatsachen. Vielmehr sollte man glauben, dass die Naturgesetze immer Gültigkeit besitzen, d. h. dass allerunwahrscheinlichste Anomalien im Ablauf des raumzeitlichen Geschehens eben für allerunwahrscheinlichst zu halten sind, und jegliches Wunder, das im Bereich des empirisch Überprüfbaren stattfindet, nur im Rahmen der Naturgesetze ablaufen kann, jedoch durch sein Auftreten in seiner ganz spezifischen Situation, durch eine Haltung des Glaubens, also alleine durch seine Interpretation, als solches erkenntlich wird. Anders gesagt: Gott hält sich an seine eigenen Naturgesetze und ein jedgliches Wunder muss im Bereich des naturgesetzlich Möglichen liegen. Wer will oder wer glaubt, kann in irgendeiner Sache ein Wunder sehen, wer es nicht tut, kann es auch aners erklären. Und keiner muss die vernünftige Annahme gewisser Naturgesetzlichkeiten aufgeben, wenn er glauben möchte, denn die Bereiche der mechanischen Erklärung (vielleicht sogar eher Beschreibung; das „Wie genau?“) und der sinngebenden Erklärung (sozusagen die Deutung; das „Warum?“ oder „Wozu?“) sind sauber von einander getrennt.
Offensichtlich entspricht aber die Behauptung einer leiblichen Auferstehung, ohne die laut Paulus das Christentum angeblich nicht funktionieren würde, nun nicht dieser Weltsicht der sauber aufgeteilten Fragen. Kein Wunder also, dass sich der Denkende dann nach einer alternativen Erklärung sehnt.
Wenn man die überlieferten biblischen Berichte einmal genauer durchliest, fällt einem auf, dass die Begegnungen mit dem Auferstandenen als eine Art persönliche oder kollektive Vision beschrieben werden. Es ist eigentlich ganz klar, auch wenn es nur zwischen den Zeilen zu lesen ist, dass der auferstandene Jesus nicht empirisch nachprüfbar etwas gegessen hat oder nach Emmaus gegangen ist, dass man die Situationen also nicht hätte fotografieren oder filmen können (Aufgrund der Art dieser Berichte kann man auch ausschließen, dass Jesus womöglich nach einer Phase des Scheintodes wieder zu seinen Jüngeren zurückgekehrt ist. Ein ehemals Scheintoter erscheint den Anwesendenen nicht plötzlich wundersam und verschwindet dann wieder, sondern ist ganz konkret da – das kann man aber beim besten Willen nicht aus den Berichten der Begegnungen mit dem Auferstandenen herauslesen, die Berichte hätten dann einen anderen Charakter und vermutlich wäre Jesus dann sogar nochmal öffentlich aufgetreten, nach einer gewissen Zeit oder andernorts.). Vielmehr wird eine Glaubenswahrheit enthüllt und dem Kreis der Nachfolger plötzlich deutlich – man ist also nur auf der Glaubensebene. Man kann solche Situationen selbstverständlich psychologisch beschreiben im Sinne der in das Mechanische zielenden „Wie?“-Frage – interpreterieren, deuten kann man es aber wieder ganz beliebig, in Konsistenz mit seinem Glauben oder eben Unglauben. Jedenfalls wurden hier bei den Erscheinungen eben keine Naturgesetze gesprengt, es ist sozusagen alles in Ordnung. Der Mensch hat die Freiheit, aufgrund des Berichtes von Visionen zu glauben oder eben nicht zu glauben, aber nichts sprengt den Bereich des Möglichen (d. h. Nicht-Allerunwahrscheinlichsten), er muss nicht gegen seine Erfahrung glauben. Ja, im Grunde würde der christliche Glauben so ja perfekt funktionieren: „Jesus wurde getötet, aber uns wurde bewusst, dass er auf irgendeine andere, nicht überprüfbare Weise weiterlebt. Wir können es nicht beweisen, aber wir sind fest davon überzeugt.“
Jetzt gibt es nur noch die Sache mit dem leeren Grab. Seien wir ehrlich, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Genau das leere Grab ist es doch, dass einen zu der – naturwissenschaftlich denkbar unwahrscheinlichen – Annahme verleiten soll, dass Jesus Leiche tatsächlich leiblich auferstanden, also zu neuem biologischen Leben gekommen ist: dass sie plötzlich wieder 37 ° Körpertemperatur hatte, das geronnene Blut wieder zu fließen begonnen hatte und die Zersetzung der feinen Nerven im Gehirn usw. rückgängig gemacht wurde. Hätte das Grab nicht einfach voll sein können? Das hätte den Erfahrungen der Anhänger Jesu mit dem Auferstandenen doch nichts genommen. Das leere Grab hat aber einen fahlen Beigeschmack, den auch die Zeitgenossen der Jünger schon wahrgenommen haben: „Seine Jünger haben ihn gestohlen.“ Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass Jünger, die diesen Betrug selbst vorgenommen haben, in einer Art Nacht- und Nebelaktion am Sabbat, dann trotzdem eine derartig feste Überzeugung von der Auferstehung Jesu entwickelt hätten, aufgrund welcher sie dann selbst vielfach bis in den Tod gegangen wären. Aber dennoch ist dem gesunden Menschenverstand und insbesondere dem naturwissenschaftlich Denkenden eigentlich klar, dass, wenn die Geschichte des leeren Grabes eine Tatsache beschreiben soll, es dann auch eine natürliche Erklärung dafür geben muss, sei es, dass irgendein Unbekannter oder Josef von Arimathäa die Leiche verschwinden hat lassen, dass die Frauen und Jünger das falsche Grab aufgesucht hatten oder Jesus, nocht nicht ganz tot, mit letzter Kraft das Grab verlassen konnte – der spekulativen Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt, solange sie den Bereich des Möglichen nicht verlässt (Es gibt sogar die Theorie, der „Auferstandene“ sei nach einem Koma nach Indien ausgewandert – dann wäre er aber höchstwahrscheinlich irgendwie seinen Jüngern nicht nur – wie oben deutlich gemacht – erschienen, sondern begegnet.). Wie auch immer es gewesen sein mag, sozusagen unphysikalisch war es wohl kaum, woran man sich als vernünftiger Glaubender gewöhnen sollte, der sonst der Lehre Jesu zuliebe oft unnötigerweise über ein genaues Nachdenken an dieser Stelle hinweggesehen hat.
Letztenendes ist das leere Grab nämlich auch egal, solange man nicht von einer leiblichen Auferstehung ausgeht (was die meisten Gläubigen heute ohnehin nicht tun): das Grab kann voll sein und Jesu Leichnam verwest darin oder es kann leer sein, weil „man meinen Herrn gestohlen“ hat, wie Magdalena sagt, d. h. dass Jesu Leichnam irgendwo anders verwest, und trotzdem kann die innere Erfahrung den Glauben an eine transzendente Auferstehung entstehen lassen. Keine leibliche Auferstehung, kein Konflikt von Natur und Glauben, keine Sprengung von Naturgesetzen, sondern Glauben allein aus dem Glauben, oder eben nicht, ein Mensch frei zum Glauben und Unglauben, so ist eigentlich alles in Ordnung.
Seien wir ehrlich, die andersartige, visionsartige Erfahrung der Anhänger Jesu entspricht doch dem, was man ohnehin fühlt, wenn man die Leiche eines toten Menschen sieht: dass die Leiche und der Mensch, der das mal war, zwei verschiedene paar Stiefel sind und der Mensch nun irgendwo anders ist, vorzugsweise im – transzendenten – Himmel. Eine leibliche Auferstehung passt doch sowieso nicht zu dieser userer intuitiven Vorstellung.
Grenzwertige Gedanken
Die Flüchtlingsthematik heizt die Geister hierzulande auf, keine Frage. Offene Grenzen, grenzenlose Gutmenschen, Obergrenzen, sexuelle Grenzüberschreitungen, Grenzen der Aufnahmebereitschaft, Obergrenzen und so weiter. Neben all diesen unzähligen, immer wiederkehrenden Themen und Argumenten hier mal noch ein paar alternative Interpretationen und Gedanken. Nicht alles hundertprozent ernst, eher ziemlich grenzwertig.
War es einfach der Sommer? Der Sommer 2015, ein Sommer wie er früher immer war – ja, noch darüber hinaus. 38 ° im Schatten, tagsüber plantschen, abends Grillparty mit Sangria. Da können doch alle mitmachen! „Hey, ihr könnt alle kommen, wir haben uns nicht so, kommt, legt euch zu uns in die Sonne! Wir werden nett empfangen in Italien oder auf Mallorca, und so seid ihr bei uns willkommen! Ob wir jetzt ein paar mehr sind, ist doch egal, zur Not schlaft ihr halt nackt im Heu! Hey, wir hängen euch keine Blumenkränze um, wie auf Hawaii, dafür bekommt ihr alle unsere Altkleider, wir wollten in den Ferien eh mal ausmisten! Willkommen bei uns!“
Haben die 38 ° unser Entscheidungsvermögen beeinflusst?
Es geht auf den Winter zu am Ende des Jahres 2015 – düster, nass-kalt, typisch deutsch. Schlechte Laune, die Leute gehen in Anoraks eingemummt missmutigen Blickes aneinander vorbei durch den schwarzen Schneematsch auf den Bürgersteigen. Nur so weit aus dem trauten Heim wie nötig! Nieselregen, überall Pfützen, zu viel Feinstaub aus unseren Autos – und die Partygäste aus dem Sommer sind immer noch in unseren Turnhallen. War es die triste Zeit, die die Stimmung kippen ließ?
Waren es die Medien und der Mainstream der Politcal Correctness auf Facebook, die Frau Merkel erpresst haben, die Grenzen zu öffnen? Man erinnere sich an das berühmte Video „Merkel und das weinende Flüchtlingsmädchen“. Da sagt Merkel noch ganz klar, „wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen, […] das können wir auch nicht schaffen.“ Ja, genau, da schon eine Kombination der Wörter „wir“, „schaffen“ und „das“, schon Wochen vor womöglich dem Auspruch ihrer Kanzlerschaft schlechthin, jetzt schon legendär, berühmt-berüchtigt. Furchtbar, wie kann man nur so hart zu einem armen Mädchen sein, so sind wir Deutschen doch nicht! Wie wurde Fr. Merkel gescholten. „Okay, die Bevölkerung will es wohl anders,“, das die Erkenntnis der Kanzlerin, „die will die Flüchtlinge aufnehmen“. Ist es eine Art Rache, jetzt trotzdem knallhart die Grenzen offenzuhalten? – „Ihr wolltet es so, ihr unlogisches Volk, jetzt sollt es ihr es haben!“
War die Sichtweise der Medien im Sommer nicht Ausdruck der Mehrheitsmeinung? Kann ein Kanzler oder eine Kanzlerin in einer Demokratie, zugegeben immer zeitversetzt, überhaupt mehr als die Mehrheitsmeinung wiedergeben? Ist es nicht blauäugig vom Volk selbst gewesen, nur brave Flüchtlingsmädchen zu erwarten, um dann durch manch tatsächlich Angekommenen ebenjene jungen Mädchen in Gefahr zu wissen? Ist es nicht umgekehrt starrsinnige Paragrafenreiterei, allen gleichberechtigt Schutz zukommenzulassen? Sollten wir nicht intuitiv nur die armen Kinder und Mütter aufnehmen und die nordafrikanisch und arabisch aussehenden Testosteron-Zombies sich gegenseitig in die Luft sprengen lassen? Ist uns überhaupt bewusst, dass wir menschlich denken, aber unser Staat einen Computer aus Paragrafen ist, der es verlangt, zwischen armen Mädchen und unbeliebten Rabauken keinen Unterschied macht, machen darf? Wissen wir, dass so eine Logik durchzusetzen auch Opfer im Handeln abverlangt, weil sie eben nicht unbedingt dem intuitiven Handeln entspricht?
Alleinstehenden, teils aggressiven jungen Männern, die hier „nur“ ein besseres Leben suchen, bereiten wir hier ein Nest, weil wir Mitleid mit armen Kindern haben, so verlangt es unser Staat. Konkurrenten im Kampf um die Fortpflanzung und die Ressourcen wollen wir doch eigentlich im Wettbewerb übertrumpfen, anstatt sie zu stärken! Kinder dagegen gilt es zu schützen! So will es unsere Biologie. Ist uns bewusst, dass der Rechtsstaat über unsere Biologie hinausgeht? Ist uns und auch den Neuen diese Errungenschaft bewusst?
War es der Feminismus, war es die Meinung der emanzipierten Frauen, die im Vergleich zu anderen Zeiten und Kulturen bei uns gleichermaßen Berücksichtigung findet? Waren es unsere Frauen, die eine Horde junger, viriler Männer nicht abhalten konnte, ja schlichtweg willkommen heißen musste? Haben Frauen, in den Medien, in der Politik, haben verweiblichte Männer, die öffentliche Meinung in diese Richtung geprägt – vielleicht ganz unbewusst? Waren weibliche Hormone am Werk, die, aufgeheizt durch den Rekordsommer, den urmännlichen Reizen unterlagen? Oder eine Art weiblicher Versogungsinstinkt für tapfere Männer? Hätte ein männlicher Kanzler da anders gehandelt als eine Kanzlerin? Ist Frau Merkel auch der Attraktion der eindringenden virilen Kraft unterlegen, in der Hitzewallung des Sommers, oder wollte sie, bekanntlich selbst kinderlos, die vielen Männer, die ihre Söhne sein könnzen, zu sich unter ihre mütterlichen Fittiche nehmen?icht unbedingt dem intuitiven Handeln entspricht?
Versucht sie diese eine Gefühlsregung ihrer Kanzlerschaft nun rückwirkend und eine bis jetzt natürlich noch durchgehaltene eiserne Prinzipientreue einer Pastorentochter zu vertuschen?
Haben die deutschen Frauen insgeheim die feminisierten deutschen Stubentiger von Männern, die in ihrer Elternzeit mit dem SUV zur Kita fahren und zu Hause auf der Krabbeldecke den Babies Brei einlöffeln, satt? Wollen sie vielleicht gar nicht immer die weiblichen Männern, die so sind, wie sie es wollen, gelüstet sie es vielleicht insgeheim nach Männern, die noch echte Kerle sind, die noch Testosteron versprühen? Fürchtet der deutsche Mann, der Christ, nicht genau deswegen den arabischen, muslimischen Mann, der es sich noch zugesteht ein Mann zu sein, sich durchzusetzen? Bewundert, beneidet er ihn nicht insgeheim sogar um sein patriarchalisches Weltbild und hofft durch die Aufnahme richtiger Männer hierzulande womöglich selbst wieder mehr Mann sein zu dürfen, auch wenn ihm natürlich verboten ist, genau solches öffentlich zu äußern?
Ist es dann nicht fast schon aberwitzig, dass die echten Kerle, denen die netten Frauen helfen wollten, jetzt zu sehr mit ihren Trieben verwurzelt sind, sodass der deutsche Stubentiger nun rechtlich und polizeilich wieder seiner Beschützerfunktion nachzukommen hat?
Sind wir nicht eigentlich doch ein bisschen Nazis, weil das ganz normal ist? Haben wir unter dem Eindruck der Bewältigung des Hitlerregimes es versäumt, ja verdammt, ein normales Bewusstsein von nationaler, kultureller und ethnischer Identität zu entwickeln? Sind wir naiv, weil wir uns alle derartige Gedanken und Gefühle, die in jedem anderen Land als vollkommen normal gelten, insbesondere bei den Geflüchteten, abtrainiert haben, da noch die kleinste Regung in diese Richtung ja schon fast ein Progrom ist? Haben wir das womöglich Gesunde mitverlernt, bei der Verdammung der größten Greueltaten der deuschen Geschichte? Birgt nicht genau dieses „Bloß nicht irgendwie rechts sein!“ – aus Furcht vor der medialen Hexenverfolgung – die Gefahr, von anderen Nationen ausgenutzt zu werden? Oder sind wir umgekehrt im 21. Jahrhundert soweit, uns als blitzender und blinkender wirtschaftlicher und moralischer Vorreiter als erstes Land über Nationalismen zu stellen und Menschen Mensch sein zu lassen, egal ob arm oder reich, weiß oder schwarz? Sind wir soweit, ein Zeichen in der Welt zu setzen – dass die Entwicklung unseres eigenen Staates und Wohlstandes vollkommen ist und wir uns nun mit voller Kraft den Problemen der Beseitigung des Leids auf der restlichen Welt widmen können?
Haben die islamistischen Terroristen, vor denen die Menschen aus dem nahen Osten zu uns fliehen und geflohen sind, nicht im Kern eigentlich Recht? Üben sie nicht, freilich mit unangemessenen Mitteln, eine vollkommen berechtigte Kritik am westlichen Wirtschafts- und Lebensstil, an der westlichen, post-religiösen Individualethik? Tragen wir denn nicht tatsächlich Schuld am Elend der vielen ärmeren Länder, in dem wir sie durch unsere eigene Profitgiert und Verschwendungssucht ausbeuten? Ist nicht unsere Moral- und Maßlosigkeit, das Prinzip der maximalen Freiheit des Einzelnen, Ursache für so vieles Elend in der Welt? Ist uns überhaupt bewusst, dass es die Schattenseiten unserer dekadenten Exzesse gibt, ja, dass es ein ständiger dekadenter Exzess ist? Ist es global betracht nicht irgendwo gut, dass wir die Konsequenzen unseres verschwenderischen und ausbeuterischen Wirtschaftssystems jetzt nicht nur in ein paar großen Kinderaugen in der UNICEF-Werbung im Fernsehen oder im Netz sehen, wo wir schnell weiterschalten oder -klicken können, sondern direkt, hier, vor der eigenen Haustür, in der eigenen Turnhalle, oder im Supermarkt damit konfrontiert sind? Stellen uns die Terroristen nicht damit die richtige Diagnose, weisen sie nicht zu Recht auf ein himmelschreiendes Unrecht hin?
Oder kann man schlichtweg nicht überall auf der Erde gleichgut leben – auf dem Nordpol oder in der Sahara lebt es sich eben auch nicht so gut und einfach wie in Mitteleuropa? Oder sind wir als Europa einfach besser als die Länder anderer Kontinente, haben wir einfach die Nase vorn, durch unsere harte und beständige Arbeit am Fortschritt, haben wir uns den höheren Standard so nicht verdient? Ist es denn unsere Aufgabe, nun für die Millarde Menschen zu sorgen, für die nicht genügend Lebensstandard da ist, die aber nunmal trotzdem, als Ergebnis einer für unsere Verhältnisse maßlosen Vermehrung, auf unserer lieben Erde leben?
Alles irgendwie ein bisschen, die Politik soll rational sein, aber doch irrationalen Menschen gerecht werden, der Mensch ist ein Tier und gleichzeitig komplex und seine komplexesten Gedankengänge können doch wieder nur Produkt billiger Triebe und klimatischer Bedingungen sein. Gut sein will der Mensch und für das Gute einstehen auch, aber anstrengend darf es dann nicht sein oder einen selbst beeinträchtigen. Der einzelne Mensch mag noch ansatzweise durchschaubar sein, aber das Wechselspiel der Menschen – das ist unvorhersehbar wie das Wetter, es sei denn man steht mit beiden Beinen auf dem gesunden Menschenverstand, dann wusste man es ja immer schon zuvor. Komplex ist also die ganze Problematik und da will man am liebsten einfache Lösungen.
Das müssen die Verantwortlichen den ganzen einfachen Leuten doch mal erklären, es ist ja auch ein Kommunikationsproblem. Dann dürfen sie wieder wählen gehen.
Zweierlei Märtyrer
Märtyrer gab und gibt es ja sowohl bei radikalen Christen als auch bei radikalen Moslems. Der Unterschied ist eigentlich nur das Vorzeichen, mathematisch gesprochen:
Der muslimische, genauer gesagt der islamistische Märtyrer jagt möglichst viele Ungläubige in die Luft, was leider auch sein eigenes Leben kostet.
Der christliche Märtyrer lässt sich von den Ungläubigen dahinmetzeln.
So oder so – rein evolutorisch ist das Märtyrertum jedenfalls keine Erfolgsstrategie.
Refugees welcome – die nachhaltige Strategie gegen den Terror
Terroranschläge in Paris, mitten in Europa – da bekommt man Angst. Da kann auch in Deutschland, dem Land der Willkommenskultur, die Stimmung gegenüber den Geflüchteten weiter kippen. Der Gedanke, Europa nun abzuschotten, liegt nahe – warum sollte man sich womögliche Gefahren ins Land holen? Auch Frankreichs Strategie, umso härter gegen die Terroristen zurückzuschlagen, ist nur zu verständlich. Um einer stetigen Ausbreitung der Terroristen entgegenzuwirken, scheinen mir militärische Einsätze gegen sie kaum vermeidbar, wenngleich mir eine vernünftigere Lösung lieber wäre – die aber ein Nachgeben der terroristischen Kämpfer zur Voraussetzung haben müsste.
Als nachhaltigere Strategie muss man aber die gegenwärtige deutsche Politik der Aufnahme der hunderttausenden von Flüchtlingen ansehen. Wir geben den zu uns Geflohenen eine Perspektive, wir lassen sie an unserem Wohlstand teilhaben. Gerade Perspektivlosigkeit und Armut sind der Nährboden für Terrorismus, den wir so zu einem zugegeben immer noch kleinen Teil beseitigen. Wer hier in unserem Land willkommen geheißen wird, dem eine Hand gegeben wird und Perspektiven auf ein besseres Leben hat, wer satt und in Sicherheit ist, wird sich schon gleich weniger radikalisieren lassen. Wenn auch noch die Frau und die Familie hier sind, sinkt die Radikalisierungstendenz noch weiter. Es ist eine Binsenweisheit, dass ungebundene junge Männer im Durchschnitt die meisten Verbrechen begehen, man muss noch nicht einmal in die Kriminalitätsstatistiken blicken – wir sind also gut damit beraten, Familien als ganzes aufzunehmen (eine Frauenquote von 50% unter den Aufgenommenen ist wohl weniger praktikabel, wenngleich in der Theorie wünschenswert). Unsere europäischen Nachbarländer sind jetzt umso mehr gefordert, dieser nachhaltigen Strategie des Willkommens und der Teilhabe am westlichen Lebensstil zu folgen. Das würde, im Gegensatz zu den vielen hübsch in der Trikolore beleuchteten Gebäuden, mehr bringen (man könnte hoffen, die Gebäude sensibilisieren dazu).
Ein Blick nach Frankreich lehrt uns aber auch, dass die Probleme mit der bloßen Aufnahme der Geflohenen in ein anderes Land keineswegs gelöst sind. In Parallelgesellschaften gescheiterter und scheiternder Zuwanderer, die nur allzu zutreffend als Ghettos bezeichnet werden müssen, hat man eben gerade den Nährboden von Armut und Perspektivlosigkeit – mitursächlich für die Ereignisse des vergangenen Freitag – im eigenen Land entstehen lassen. Wir tun uns also gut daran, die zu uns Geflohenen so gut wie irgend möglich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Sprachkurse (vielleicht auch Arabisch für Deutsche), Ausbildungsmöglichkeiten und ein frühzeitiger Einstieg in den beruflichen Alltag sind da unerlässlich. Der Staat muss den Kontakt zwischen deutscher und ausländischer Bevölkerung zum Beispiel durch steuerliche Gratifikationen für ehrenamtlich Tätige oder Medienkampagnen begünstigen. Auch eine Verteilung der neuen Mitbürger auf das gesamte Land, gerade auch aufs Land und in kleinere Städte, muss zur Vermeidung der Clusterbildung umgesetzt werden. Es ist aber auch klar, dass dies alles nur bis zu einer Obergrenze von wohl einigen Millionen, aber sicherlich nicht acht Millionen oder mehr funktionieren wird. Man muss nicht bis zur Selbstaufgabe helfen, es nutzt keinem, wenn wir unsere eigene Stabilität in Gefahr bringen, wenn gewisserweise die Löschdecke selbst Feuer fängt. Selbstverständlich ist der Westen dann aber immer noch in der Verantwortung, wieder ein sicheres Leben in den Ursprungsländern zu ermöglichen, welches in meinen Augen zumindest idealerweise dem Leben in einer anderen Kultur übergeordnet ist.
Sicherheit wollen wir aber auch vor Ort. Es ist nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, das unter den hunderttausenden eingereisten Flüchtlingen auch potentielle Terroristen sind (so wie sich unter der gleichen Menge Deutscher auch potentielle Kindsmissbraucher befänden). Es war ein großer Fehler, die Grenzen nicht sofort zu schließen und die Flüchtlinge nur nach Kontrolle und Registrierung zu uns zu lassen. Zumindest für die Zukunft ist ein solches Vorgehen meiner Meinung nach kein Ausdruck einer rechten Gesinnung oder Absonderungspolitik, sondern ein Gebot der zu garantierenden inneren Sicherheit. Dem Fehler der offenen Grenzen muss man nun mit zusätzlichen Aufwendungen der Geheimdienste und der Polizei und Präventionsmaßnahmen begegnen.
Noch einmal aber: die gegenwärtige deutsche Politik ist die richtige. Wir bekämpfen den Terror so nicht direkt, wir lindern ihn. In einer unvorstellbaren Zeit des Wohlstands und des Friedens in Deutschland, in der – mit Verlaub – der offenbar größte politische Streit sich an der bloßen Bezeichnung der Ehe von Homosexuellen als ebensolche oder als Lebenspartnerschaft entfachten, während jenseits unseres, aus immer weiterer Ferne sichtbaren Elfenbeinturmes Krieg, Perspektivlosigkeit und Armut herrschen, ist es schlichtweg unsere menschliche Pflicht, uns dieser Probleme anzunehmen. Der Vorwurf der Terroristen, wir seien eine morallose Gesellschaft, ist so schnell entkräftet.
Was mir bei den Flüchtlingen fehlt
Gleich vorab: nein, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, denn wer mit dem Tod bedroht wird, dem muss man helfen, wenn man es kann und wir furchtbar wohlhabenden Europäer können das, solange wir wollen. Es ist klar, dazu muss der Zusammenhalt in Europa gegeben sein und von wirklich lächerlich übertrieben Angstreaktionen – der Zaun in Ungarn scheint mir eine Verdrängung der Angst vor der eigenen Empathie, die zur Hilfe führen muss, zu sein, eine Verdrängung in Form von Maschendrahtzaun – abgesehen werden. Es kann doch nicht in erster Linie darum gehen, dass das ruhige europäische Vorgartenleben ein wenig gestört wird, wenn Menschen Hilfe benötigen, denen andernorts die Hand oder der Kopf abgehackt werden. Doch anstelle zu helfen und so die Probleme zu lindern, kann man sich auch mit einem Zaun die Probleme vom Hals schaffen – human, geschweige denn christlich ist das aber definitiv nicht mehr. Es wäre ja noch verständlich, wenn es bei der ganzen Sache tatsächlich um Ressourcen ginge, denn wer selbst nicht genug zu leben hat, will das wenige nicht auch noch teilen, aber davon sind wir, gemessen an dem wenigen, was ein Flüchtling, ein Mensch, wirklich zum Überleben braucht, meilenweit entfernt – vielmehr sind, auch wenn der Beigeschmack von Sklavenhandel dabei ist, die Eintreffenden für unsere Länder auch human capital. Nein, wir brauchen Zusammenhalt in Europa, der nicht mehr vielleicht drohende marginale Einbußen im eigenen Wohlstand oder minimale Vorteile oder Nachteile im europäischen Wettbewerb im Blick hat, sondern sich der Verantwortung gegenüber realer Not stellt. Dass sich Frau Merkel wieder daran erinnert hat, Christin zu sein und dementsprechend zu handeln, mögen da Schritte in die richtige Richtung gewesen sein.
Was mich aber mehr als die fehlende europäische Einheit stört ist die fehlende Einheit unter den Flüchtlingen selbst. Warum organisieren sie sich nicht? Warum gibt es keinen Verband der Vertrieben aus Syrien, warum keine konzertierte Aktion? Warum keine Flüchtlingspolitiker, keine Flüchtlingsvertreter? Warum keinen Moses, keinen Aeneas, keinen Anführer derer, die ins gelobte Land gezogen sind und noch ziehen? Gewiss, wer direkt aus dem Krieg kommt, mag erst einmal andere Sorgen haben, aber viele Flüchtlinge in Deutschland sind schon Monate hier in Sicherheit und, auch durch unseren Staat verschuldet, nicht gerade überbeschäftigt – da wäre genügend Zeit zur Formierung einer Organisation, die in Zusammenarbeit mit dem deutschen Staat die Hilfe für die noch kommenden Flüchtlinge organisiert, Selbsthilfe sozusagen, und die Zukunft all der Landsleute in Not plant. Warum gibt es eigentlich keinen Anführer der Flüchtlinge, der in der Öffentlichkeit das Wort ergreift, der für ihre Rechte kämpft, der legitimiert und auf Augenhöhe ist um mit den europäischen Politikern an einem Tisch problemorientiert zu verhandeln? Warum nimmt da keiner der gebildeten Syrer das Ruder in die Hand?
Was mir fehlt, das ist die positive Vision, das ist der Patriotismus, das sind die Ideale. Warum tritt da keiner aus den Flüchtlingen heraus und sagt, wie es sein soll, das heißt, was ein mögliches Ziel ist, auf das es hinzuarbeiten gilt?
„Meine lieben Landsleute, wir alle hatten es satt, in einem Land zu leben, in dem wir vom Terror umgeben sind. Wir sind geflohen vor der Angst um unser Leben und das vereint uns. Wir sind jetzt in Sicherheit und müssen, gemeinsam mit unseren Gastländern dafür Sorge tragen, dass unsere Brüder und Schwestern auch noch in Sicherheit kommen. Wir danken unseren Gastländern für ihre Aufnahmebereitschaft und die Hilfe, auch wenn wir wissen, dass wir für viele Einheimische wie Fremdkörper wirken. Wir hoffen, auch noch weitere Hilfe zu erhalten – auch wenn wir kaum mehr als bitten können. Wir sind in Not, wir brauchen Hilfe! Aber, liebe Landsleute, seien wir ehrlich, wir lieben unser Land, unsere Heimat. So gut es uns hier geht und so freundlich wir aufgenommen worden sind, so sehr möchten die meisten von uns im Herzen doch irgendwann wieder zurückkehren. In ein Land, das wieder sicher ist. In einen Staat, der ein geregeltes Leben ermöglicht. In eine Wirtschaft, die jedem ein erschwingliches Leben führen lässt. Bauen wir uns eine Gesellschaft, so wie wir sie hier erleben dürfen, auch bei uns auf. Packen wir es an, stecken wir die Terroristen ins Gefängnis. Bitten wir die reichen Länder um Hilfe dabei, auf dass wir bald in unsere Heimat zurückkehren können. Bitten wir sie um Zusammenarbeit beim Aufbau eines neuen Syrien. Packen wir es an!“
Warum sagt das keiner? Warum gibt es keinen, der soviel Mut hat?
Der einsame Vogel
– oder der Popp-Star –
Als die Vögel erwachsen wurden, begannen die Männchen langsam, pfeifen zu lernen. Pfeifen, damit sich bald ein Weibchen für sie interessieren würde, mit dem sie dann ihr weiteres Vogelleben verbringen würden. Einer um den anderen pfiff, um das richtige Weibchen anzulocken, mit dem sie dann gemeinsam Kinder großziehen würden, dem sie dann möglichst fette Würmer ins Nest bringen würden. Mancher pfiff eine kurze Melodie, machner eine etwas längere, der eine traf die Töne der, andere weniger, je nachdem. Aber alle fanden sie bald das richtige Weibchen, ein kleineres oder ein größeres, ein hübsch gefiedertes oder ein etwas zerzaustes, je nachdem; bald ging es für sie los mit der eigentlichen Arbeit eines Vogels, mit der Beschaffung von Würmern, von kleineren oder größeren, von prächtigen oder weniger prächtigeren, je nachdem.
Nur einer der jungen Vögel hatte kein Glück: durch eine üble Laune der Natur pfiff er nicht einfach irgendetwas wie seine Altersgenossen, nein, er pfiff Mozart. Je nach Lust und Laune pfiff er die Melodien von Klaviersonaten, Konzerten oder von Symphonien, bei schlechter Laune auch mal die des Requiems. Wie gerne hätte er damit ein Weibchen beeindruckt, doch den meisten gefiel das alles zwar schon irgendwie, aber letzten Endes war ihnen dann doch ein schlichterer Musikant lieber. Und die paar wenigen, die vielleicht doch einen gemeinsamen Nestbau im Sinn gehabt hätte, die sagten ihm selbst nicht zu, denn er hätte ihnen ein um das andere Mal vergeblich zu erklären versucht, dass er nicht Beethoven, nicht Schubert, auch nicht Bach pfiff, ja erst recht nicht Beatles-Songs, sondern nur Mozart – nein, nicht auszudenken, das hätte am Ende bestimmt viel Streit gegeben.
Und so blieb dieser Sonderling von Vogel, selbst unter den Vögeln ein Vogel, einsam. Es wollte einfach nicht Zeit werden, dass er für die Liebe und den Nachwuchs Würmer hätte anschaffen müssen – wo er, so war er sich sicher, durch die Laune der Natur doch sicherlich auch im Stande gewesen wäre, kleine Schnecken herbeizubringen, was die anderen gar nicht vermochten. Hier, im heimatlichen Wäldchen, fand er einfach nicht, was er suchte und so beschloss er, auf Reisen zu gehen. In den Bergen, in den Tälern, am Fluss und an der See, überall pfiff er vor sich hin. Überall gefiel er den Weibchen, aber dann doch zu sehr, als dass ihn eines zu sich genommen hätte. Der Applaus und die kurzen Umarmungen seiner Fans jedoch waren ihm sicher und das genügte ihm schon, es tröstete ihn über seine Einsamkeit hinweg. Bald flog er aber wieder weiter, in andere Länder, weil er ja immer noch nicht das Gefühl hatte, am Ziel angekommen zu sein.
Viele Jahre zogen über das Land und der einsame Vogel hatte längst schon die Hoffnung aufgegeben, irgendwann das richtige Weibchen für sich zu finden. Nein, so dachte er, bei mir ist das anders, mein Beruf ist es nicht, Würmer heranzuschaffen, mein Beruf ist es, zu pfeifen und zu gefallen. So dachte er und sein Denken machte seine Not zur Tugend, aus seinen Lockrufen wurde Kunst, aus einem leidenden Romantiker wurde ein zufriedener Berufsmusiker.
Noch einmal viele Jahre später war der einsame Vogel längst gestorben. Und doch erinnerte man sich überall, über Länder und Meere, an diesen einen Vogel – denn überall, wo er war gab es bald ein paar Jungvögel, die auch Melodien von Mozart pfiffen. Wie er ihnen das wohl beigebracht hat – war er denn, als sie geschlüpft sind, nicht schon fortgeflogen? Doch zu faul, Würmer, geschweige denn Schnecken, zu fangen, waren sie allesamt, Mozarts Söhne.
Komm mit mir
Nachts ist es schon wieder und ich bin alleine unterwegs. Zur Linken und Rechten des Weges dunkle Bäume, kühler jetzt die Luft als an den vergangenen paar Sommertagen. Sogar ein wenig silbriger Nebel steigt aus den feuchten Wiesen, die sich auf der einen Seite des Weges entlang eines kleinen Baches ziehen. Nach den letzten, geradezu ekstatischen Sommernächten scheinen mir nun auch die Grillen und die Frösche eine Erholungspause nötig zu haben.
Alleine bin ich unterwegs, auf dem Heimweg von einer netten Gesellschaft, von Freunden, die mich doch nur kurz von meiner Einsamkeit ablenken konnten. Die Natur jetzt in der nächtlichen feuchten Kühle – was unterscheidet sie schon von den tiefen Gedanken, von der Technik und der Wissenschaft, denen ich mich verschrieben habe? Genauso menschenleer, genauso alleine kämpfe ich mich dort in der Grübelwelt fort wie jetzt hier, auf dem Weg. Wäre es ein Sommertag gewesen, tiefe Gefühle hätten mich auf dem einsamen Heimweg, weiter in die Einsamkeit zu Hause, aufgewühlt, doch heute ist es eher eine Art Gefühlsleere, keine Gleichgültigkeit, aber auch kein großer innerer Kampf gegen die unvermeidliche Heimkehr, hin zu meinem Schreibtischleben.
Als ich so vor mich hintrotte, tritt mir auf einmal eine Gestalt ins Blickfeld. Ohne sich von mir groß stören zu lassen, geht da ein junger Mann, Anfang zwanzig, freudigen Schrittes an mir vorbei, seinen frohen Blick nur kurz mir zugewandt, wie zu einem Gruß. Ein Wandersmann, leise singend, mit Wanderstock, Hut, Weste und einem roten Halstuch. Anmutig und unbeirrt geht er seinen fröhlichen Weg weiter, weg vom meinem Weg, hinüber zu den Wiesen und in Richtung des Baches; der Tritt seiner rundlichen Stiefel ist stark und weich zugleich. Wie ein prächtiger Hengst, wie ein reich geschmückter Bulle, auf der Höhe seiner selbst und in reiner Freude über seine eigene Schönheit geht er so dahin ins Dunkle.
Nicht sofort kehren meine Tiefsinnigkeiten nach dieser unwirklichen Begegnung wieder, wie im Schweife eines Kometen war ich noch im Nachhinein belebt und meine Versteinerung war unterbrochen. Wie rein, wie heilig dieser war, man kann es ihm nicht verübeln. Sicherlich, so dachte ich, zieht er so frohgemut in das nächste Wirtshaus, zum Weingenuss bei rotbackigen Mädchen, oder er kommt von da. Ach ja, du weckst hübsche Bilder in mir, ich will es dir danken auf meinem dunklen Weg!
Doch, schon auf der kleinen, hölzernen Brücke über dem leise rauschenden Bächlein angelangt, da dreht er sich nochmal um und blickt mich mit seinen großen, braunen Augen aus seinem fast noch kindlichen, gleichmäßig geformten Gesicht an. „Komm mit mir!“, so sagt er. Er sagt es ganz leise, flehentlich und sehnsuchtsvoll, und doch in keinster Weise in seinem Frohsinn getrübt, und ich höre es nur, weil er mir jetzt eigentlich direkt gegenüber steht und nicht dort drüben bei der Brücke. „Komm mit mir! Wo ich bin, da ist es schön, du weißt es, du warst doch auch schon dort!“ Ich spüre, wie bei diesen Worten eine eigenartig liebevolle Kraft des gewaltigen Begehrens, die mich mit ihm mit, ja noch mehr zu ihm hin ziehen möchte, von ihm ausströmt.
„Ja, ich weiß“, sage ich ihm, „ewige, kindliche Freude! Sinnenfreuden, und doch voller Heiligkeit. Wie gern käme ich mit, wie gern käme ich dorthin zurück, aber ich war dem wirklichen Ziel schon so nahe, musst du wissen, ich habe das wahre Ziel schon gefühlt, ich kenne es schon. Keine Frage, ich muss jetzt viel mehr durchs Dunkel, immer wieder, aber das ist richtiger so für mich, das ist wahrer; es ist wie in einem Gesetz geschrieben, es muss so sein!“
Wohin will die Biotechnologie?
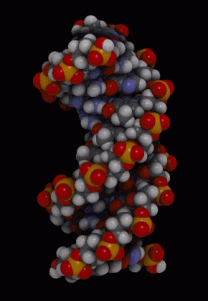 Die aktuellen Fortschritte in der Biotechnologie lassen es ja immer realistischer erscheinen, dass der Mensch nicht nur Baktieren zur Treibstofferzeugung oder künstliche Organe heranzüchtet, indem er einen von ihm programmierten, designten Erbcode zu Leben erweckt, sondern schließlich auch noch sich selbst, sein eigenes genetisches Programm, zu optimieren beginnt. Was mit der Beseitung von Erbkrankheiten beginnt, zieht dann immer neue Kreise und immer mehr Eigenschaften seiner selbst werden in Frage gestellt und als abänderbar angesehen.
Die aktuellen Fortschritte in der Biotechnologie lassen es ja immer realistischer erscheinen, dass der Mensch nicht nur Baktieren zur Treibstofferzeugung oder künstliche Organe heranzüchtet, indem er einen von ihm programmierten, designten Erbcode zu Leben erweckt, sondern schließlich auch noch sich selbst, sein eigenes genetisches Programm, zu optimieren beginnt. Was mit der Beseitung von Erbkrankheiten beginnt, zieht dann immer neue Kreise und immer mehr Eigenschaften seiner selbst werden in Frage gestellt und als abänderbar angesehen.
Kaum ein Fundament der menschlichen Gesellschaft scheint noch sicher zu sein bei der Möglichkeit, sich selbst als Wesen neuzuerschaffen. Warum noch so lange zur Schule gehen, wenn sich der Mensch doch intelligenter machen kann und dadurch schneller lernt? Warum überhaupt noch zur Schule gehen, wenn doch das bereits vorhandene Wissen und wichtige Fertigkeiten schon von Geburt an einprogrammiert sein könnten? Warum überhaupt noch eine mühsame Geburt auf sich nehmen, wenn man doch auch einen Menschen erschaffen kann, dessen Nachwuchs aus dem Reagenzglas schlüpft? Warum überhaupt noch lästige Landwirtschaft betreiben, wenn doch auch ein neuer Mensch geschaffen werden kann, der seinen Energiebedarf über das Sonnenlicht deckt, wie eine Pflanze Photosynthese betreibend? Warum noch so lästige Dinge wie Schmerzen, wenn da doch eine wertfreie Information genügen würde, warum noch Älterwerdenmüssen oder Sterbenmüssen? Es sind wohl kaum Grenzen gesetzt, immer mehr Probleme und Imperfektionen des Menschen zu beseitigen – mit unzähligen Updates wird das System Mensch immer weiter optimiert.
Am Ende sitzt er dann da der neue Mensch, in seiner perfekten Welt, doch sein perfekter, hochmotorisierter Geist hat auf einmal gar keinen Zweck mehr, denn alle Probleme sind ja bereits gelöst. Das einzige Problem allerdings, welches noch bleibt, das ist seine Langeweile – oder anders ausgedrückt: der Drang, Probleme lösen zu wollen, immer noch vorhanden, wo es doch gar keine Probleme mehr gibt, wo doch schon alles von alleine läuft. Und so beschließt der neue Mensch, sein eigenes Erbgut und in seiner fast grenzenlosen Macht auch die gesamte Welt auf ein neues zu verändern. Was dann bleibt, ist einfach eine glatte Kugel, bar jeglicher Gefahren, und auf ihr die Exemplare der finalen Version des Menschen, die aussehen wie simple Steine. Sie haben nichts, sie brauchen nichts, sie haben keine Probleme und auch keine Langeweile mehr, sie wollen nichts und auch niemandem anderem etwas. Die perfekten Menschen in der perfekten Welt liegen einfach nur herum und genießen die Sonne. Wie im Märchen „Der Fischer und seine Frau“ ist die nach noch immer mehr strebende Evolution schließlich und mit logischer Konsequenz zu ihrem Anfang zurückgekehrt. Die neuen Menschen sind eigentlich Tote, aber sie sind auf ewig glücklich – sie haben sich den Himmel auf Erden geschaffen.
Über gute und bessere Taten
Wohltaten sind gut, ohne Frage. Ehrenamtliche Nachhilfe, Pflege von Verwandten, Spenden, Engagement in Organisationen, Flüchtlings- und Entwicklungshilfe – das ist alles gut.
Manche tun es, um andere damit zu beeindrucken, um sich zu profilieren, um durch die eigene „social responsibility“ Werbung für sich zu machen oder um den Forderungen eines religiösen Systems gerecht zu werden – um Gott zu gefallen. Wie auch immer, die Triebfeder, die zu den Wohltaten führt, ist eigentlich egoistisch: das Tun für andere ist im Grunde ein Tun für sich (prosoziales Verhalten sichert den Rang in der menschlichen Gattung). Durch das Engagement steigt vor allem auch das eigene Anerkennen. Man mag von diesen Motiven halten was man will, am Ende kommen doch Wohltaten zustande, am Ende kommt doch Gutes Benachteiligten zu gute. Da kann man doch die Anerkennung schenken.
Andere tun jedoch Gutes nur um anderer Willen, aus wahrer Liebe zu anderen, ja oft sogar fremden Menschen heraus. Wie viel besser ist das! Es kommt am Ende zwar ebenso Gutes heraus, aber das Gute kommt schon vom Guten her, das Gute ist sozusagen reiner. Wenn man ehrlich ist, sind wohl nur sehr wenige Menschen zu diesem besseren Guten fähig, man mag sie „Heilige“ nennen. Es gehört nämlich sehr viel dazu, über allen tierischen Wettstreit hinweg, zu dem auch der Drang, das eigene Ansehen zu steigern – um des eigenen Vorteils Willen – gehört, im anderen, auch im Fremden, einfach nur einen anderen Menschen zu sehen und ihm um seiner selbst willen Hilfe zu bieten. Wahre Hinwendung zum Du, auch zum fremden Du, statt zum Ich, das ist das macht die besseren guten Taten aus.


